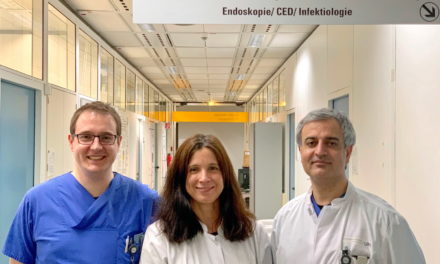Im Charakter-Interview gehen Prof. Dr. med. Jens Wiltfang, PD Dr. rer. nat. Claudia Bartels und PD Dr. Niels Hansen auf die Bedeutung neu entwickelter Alzheimer-Therapien ein, die nicht mehr nur Symptome lindern, sondern in Aussicht stellen den Krankheitsverlauf zu bremsen.
Interview: Ulrich Drees | Fotos: UMG, Adobe Stock
Herr Prof. Wiltfang, würden Sie kurz den bisherigen Stand der Behandlungsmöglichkeiten bei Alzheimer-Demenz erläutern?
Bis vor Kurzem gab es nur drei medikamentöse Therapien, mit denen wir die Symptome einer Alzheimer-Demenz mindern. Sie alle beeinflussen den Verlauf der Krankheit nicht nennenswert, sondern mildern nur die damit einhergehenden Symptome. Das sind zum einen die Acetylcholinesterase-Hemmer, die den normalerweise raschen Abbau des Neurotransmitters Acetylcholin – zuständig für unsere geistige Leistungsfähigkeit – verlangsamen. Ein zweites Medikament zur Behandlung einer fortgeschrittenen Alzheimer-Demenz verhindert, dass über einen Antagonismus am N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptor im Gehirn das Glutamat eine neurotoxische Wirkung entfalten kann. Drittens bietet der pflanzliche Wirkstoff Ginkgo eine Therapiemöglichkeit, deren Wirkung wissenschaftlich jedoch noch nicht ausreichend erforscht ist.
Welche Bedeutung hat die Alzheimer-Demenz als Erkrankung?
Jede zweite Demenzerkrankung – und wir unterscheiden mehr als 70 Varianten – ist eine Alzheimer-Demenz oder eine ihrer Mischformen. Nun liegt die geschätzte mittlere Lebenserwartung in Deutschland heute bei fast 90 Lebensjahren, und jeder dritte Mensch erkrankt mit 90 Jahren an einer Demenz. Das heißt, das von zehn neugeborenen KIndern ein bis zwei voraussichtlich an einer Alzheimer-Demenz erkranken werden. Eine wirksame Alzheimer-Therapie ist also extrem wichtig.
Und nun gibt es Fortschritte?
Es gibt einen Hoffnungsschimmer, der auf den Ergebnissen einer Forschungsgruppe in der Schweiz beruht. Diese entdeckte bei hochbetagten Menschen, die trotz Risikofaktoren für Alzheimer geistig völlig frisch geblieben waren, einen Antikörper namens Aducanumab. Dieser Antikörper band an aggregierte Formen des Amyloid-Beta Protein an, das wesentlich für die Pathogenese der Alzheimer-Krankheit ist, so dass diese anschließend von den „Polizeizellen“ des Gehirns, den Gliazellen, beseitigt werden konnten. Um seine Wirkung für Alzheimer-Erkrankte zu nutzen, wurde dieser Antikörper dann isoliert und biotechnologisch hergestellt.
Das klingt wie ein Durchbruch …
Natürlich mussten vor einer Zulassung dieses Antikörpers umfassende Studien durchgeführt werden – im Falle von Aducanumab waren es zwei groß angelegte Studien. Da das Medikament die nötigen Bedingungen für eine Zulassung jedoch nur in einer dieser Studien erfüllte, erteilte die amerikanische Gesundheitsbehörde Aducanumab nur unter der Bedingung einer dritten weltweiten Studie die Zulassung. An dieser Studie, deren Ergebnisse über die Zukunft des Medikaments entscheiden werden, nehmen auch wir als Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Göttingen teil.
Wurden auf der Basis der erfolgreichen Forschungen in der Schweiz auch weitere Ansätze verfolgt?
Ja, ein zweiter Antikörper „Lecanemab“ erwies sich als „Musterknabe“ und erfüllte alle primären und sekundären Zielkriterien einer weltweit angelegten Studie. In den USA ist er bereits zugelassen, in Europa dürfte das noch in diesem Jahr folgen, und für Deutschland erwarte ich eine Zulassung für April oder Mai 2024. Dann gäbe es auch in Deutschland eine erste zugelassene Antikörper-Therapie gegen die Alzheimer-Demenz.
Mit „Donanemab“ gibt es darüber hinaus noch eine dritte, sehr vielversprechende Antikörper-Therapie. Eine Zulassung in den USA und Europa ist wahrscheinlich und meiner Einschätzung nach in Deutschland für Ende 2024 zu erwarten.
Wie werden diese Medikamente dann praktisch eingesetzt?
In Form regelmäßiger Infusionen – im Falle von Lecanemab beispielsweise alle 14 Tage. Auch subkutane Applikationen scheinen prinzipiell zukünftig möglich zu sein. Um diese Behandlungen so gut wie möglich zu nutzen, sollten sie möglichst früh einsetzen. Das bedeutet: Wir brauchen eine möglichst effektive Frühdiagnostik. Momentan ist es jedoch so, dass die pathologische „Lawine“ dieser Erkrankung zu dem Zeitpunkt, zu dem wir sie klinisch nachweisen können, den Hirnkortex Betroffener bereits mit voller Wucht erreicht hat. Dieser Prozess – und das wissen wir sicher – beginnt jedoch bereits mindestens 15 Jahre früher. Dann bemerken Betroffene bereits erste Einschränkungen, z. B. der Merkfähigkeit, oder Wortfindungsstörungen, die wir subjektives kognitives Defizit nennen. Auch die nächste Stufe, die leichte kognitive Störung, bei der Erkrankte ihren Alltag noch bewältigen können, setzt bereits ca. 5-10 Jahre vor der eigentlichen Demenz ein. Klinische Tests ergeben in den ersten beiden Phasen noch keinen bzw. einen nur leicht auffälligen Befund. Doch über eine Untersuchung des Hirnwassers – und zukünftig auch durch einen deutlich einfacheren Bluttest – können wir spätestens die Alzheimer-Vorstufe der leichten, kognitiven Störung mit 90-prozentiger Sicherheit diagnostizieren, sodass wir den Verlauf der Erkrankung bereits lange vor dem Ausbruch der eigentlichen Demenz entscheidend bremsen könnten. Daraus ergibt sich, dass auch ein Ausbau der Alzheimer-Diagnostik wichtig werden wird.
Was ist über Nebenwirkungen bekannt?
Grundsätzlich gilt in der Schulmedizin, dass etwas, das wirkt, auch Nebenwirkungen hat – und je stärker die Wirkung, desto stärker die Nebenwirkungen. Im Kontext dieser Antikörper-Therapien wurden Hirnödeme und Hirnblutungen beobachtet, die aber bei der Mehrzahl der Patienten keine oder nur leichte Symptome hervorrufen und im Verlauf rückläufig sind.
Deshalb wird die Einführung dieser Therapien auch durch eine Sicherheitsbildgebung mittels einer regelmäßigen Kernspintomographie begleitet werden müssen – insbesondere bei Patienten mit bekannten Risikofaktoren.
Wie sind die Reaktionen in der Fachwelt?
Hier gibt es große Unterschiede. Zum einen werden die Nebenwirkungen diskutiert, wobei von den Kritikern der Therapie gelegentlich Einzelfälle unseriös überbewertet werden, wobei auch die Befürworter manchmal einzelne Erfolge zu sehr betonen. Auch die hohen Kosten der Behandlung im Verhältnis zu den Ergebnissen werden diskutiert. Nicht zuletzt spielt ein prinzipielles Misstrauen gegenüber den kommerziellen Interessen der Pharmaindustrie eine Rolle. Aus meiner Sicht bilden diese neuen Behandlungsmöglichkeiten für die Alzheimerbehandlung jedoch eine wirklich vielversprechende Perspektive. Natürlich wird es Nachfolgestudien geben müssen, um genauer zu ermitteln, bei welchen Patienten die aufwendige Behandlung Sinn macht, aber grundsätzlich begrüße ich diese neuen Ergebnisse.
Frau Dr. Bartels, wie bewerten Sie die Entwicklung?
Mit diesen neuen Antikörper-Therapien haben wir endlich eine Möglichkeit, bereits im frühen Stadium einer Alzheimer-Erkrankung Medikamente zu verordnen, die den Verlauf der Krankheit und nicht nur ihre Symptome verändern. Bemerkenswert ist auch, dass die letzte Entwicklung eines Alzheimer-Medikaments nun 15 Jahre zurückliegt. Seither hat die Pharmaindustrie zwar Milliarden in Forschungsprojekte investiert, jedoch keine Erfolge erzielt. Einige Konzerne haben sich bereits aus diesem Gebiet zurückgezogen. Die aktuelle Entwicklung führt jedoch erkennbar zu neuen Investitionen. Gleichwohl geht es bei den neuen Therapien nicht darum, dass der Hausarzt einfach ein Medikament verschreibt, das sich die Patientinnen und Patienten von der Apotheke holen und einnehmen. Die Behandlung wird ärztlich eng betreut erfolgen müssen. Es braucht entsprechende Strukturen für die Diagnostik, Infusionsplätze und neben der Kernspintomografie zur Überwachung der Nebenwirkungen auch eine klinische Kontrolle zur Wirkung und anderen Nebenwirkungen
Herr Dr. Hansen, wie bewerten Sie als klinischer Leiter der Gedächtnisambulanz das Thema Nebenwirkungen? Schreckt das Patientinnen oder Patienten ab, die jetzt z. B. an der Aducanumab-Studie teilnehmen?
Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es zwischen den verschiedenen Antikörper-Therapien auch beim Auftreten von Nebenwirkungen Unterschiede, sodass vermutlich differenziert von Fall zu Fall abgewogen werden kann, wo der Einsatz welchen Medikamentes sinnvoll ist. Erwähnenswert ist auch, dass die beobachteten Nebenwirkungen – Hirnblutungen und Ödeme – sich häufig von allein zurückbilden, also keine konkreten Symptome hervorrufen und nur im Monitoring auffallen. Selbstverständlich ist eine gute Aufklärung über alle Risiken unverzichtbar. Angesichts der Auswirkungen einer Alzheimer-Demenz entscheiden sich unserer Erfahrung nach trotzdem die allermeisten Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer dafür, diese Risiken einzugehen.
Die Alzheimer-Demenz
Diese auch „Morbus Alzheimer“ genannte Erkrankung des Gehirns ist die häufigste Form der Demenz. Benannt wurde sie nach Dr. Alois Alzheimer, einem deutschen Psychiater und Neuropathologen, der 1906 erstmals ihre Symptome beschrieb.
Die Alzheimer-Demenz führt durch das Absterben von Nervenzellen im Gehirn zu zunehmender Vergesslichkeit und Orientierungslosigkeit. Betroffene leiden unter Verhaltensveränderungen, werden unruhig, depressiv oder aggressiv. Urteilsvermögen und Sprachfähigkeit lassen nach. Da das Risiko einer Erkrankung vor allem mit zunehmendem Alter steigt – nur in weniger als einem Prozent aller Fälle wird Alzheimer genetisch vererbt –, stellt die Alzheimer-Demenz für eine immer älter werdende Gesellschaft eine riesige Herausforderung dar.
Die Ursachen der Erkrankung sind noch nicht endgültig erforscht, klar ist jedoch, dass zwei Formen von Eiweißablagerungen im Gehirn eine wichtige Rolle spielen: Plaques aus Beta-Amyloid und Fibrillen aus Tau.
Haben Sie Interesse an einer Studienteilnahme oder wünschen Sie eine diagnostische Abklärung?
Bitte wenden Sie sich an:
Gedächtnisambulanz
Robert-Koch-Straße 40
37075 Göttingen
Telefonische Sprechzeiten:
Mo: 10.00-12.00 Uhr und Do: 14.00-16.00 Uhr
Telefon: 05 51 / 39-60614
(Sekretariat Gedächtnisambulanz)
gedaechtnisambulanz@med.uni-goettingen.de

Prof. Dr. med. Jens Wiltfang
Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universitätsmedizin Göttingen, klinischer Standortsprecher des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen, Göttingen (DZNE-Gö)

PD Dr. rer. nat. Claudia Bartels
leitende Psychologin und Verwaltungsprofessorin, Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie

PD Dr. Niels Hansen
klinischer Leiter der Gedächtnisambulanz
Universitätsmedizin Göttingen
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Georg-August-Universität
Von-Siebold-Straße 5
37075 Göttingen
https://psychiatrie.umg.eu